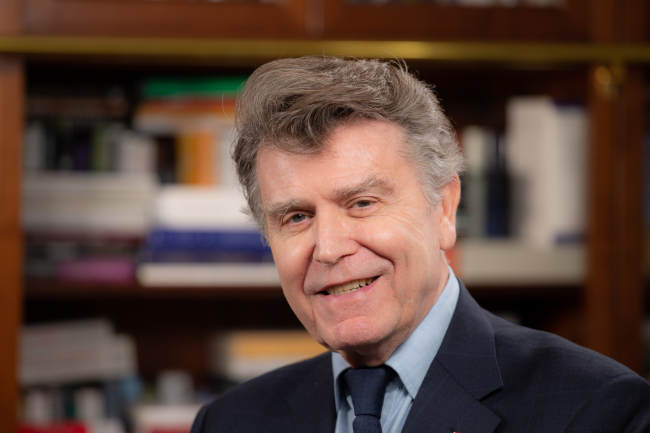"Jusqu’ici, tout va bien" ? Deutsche und Französische Protestkultur im Vergleich
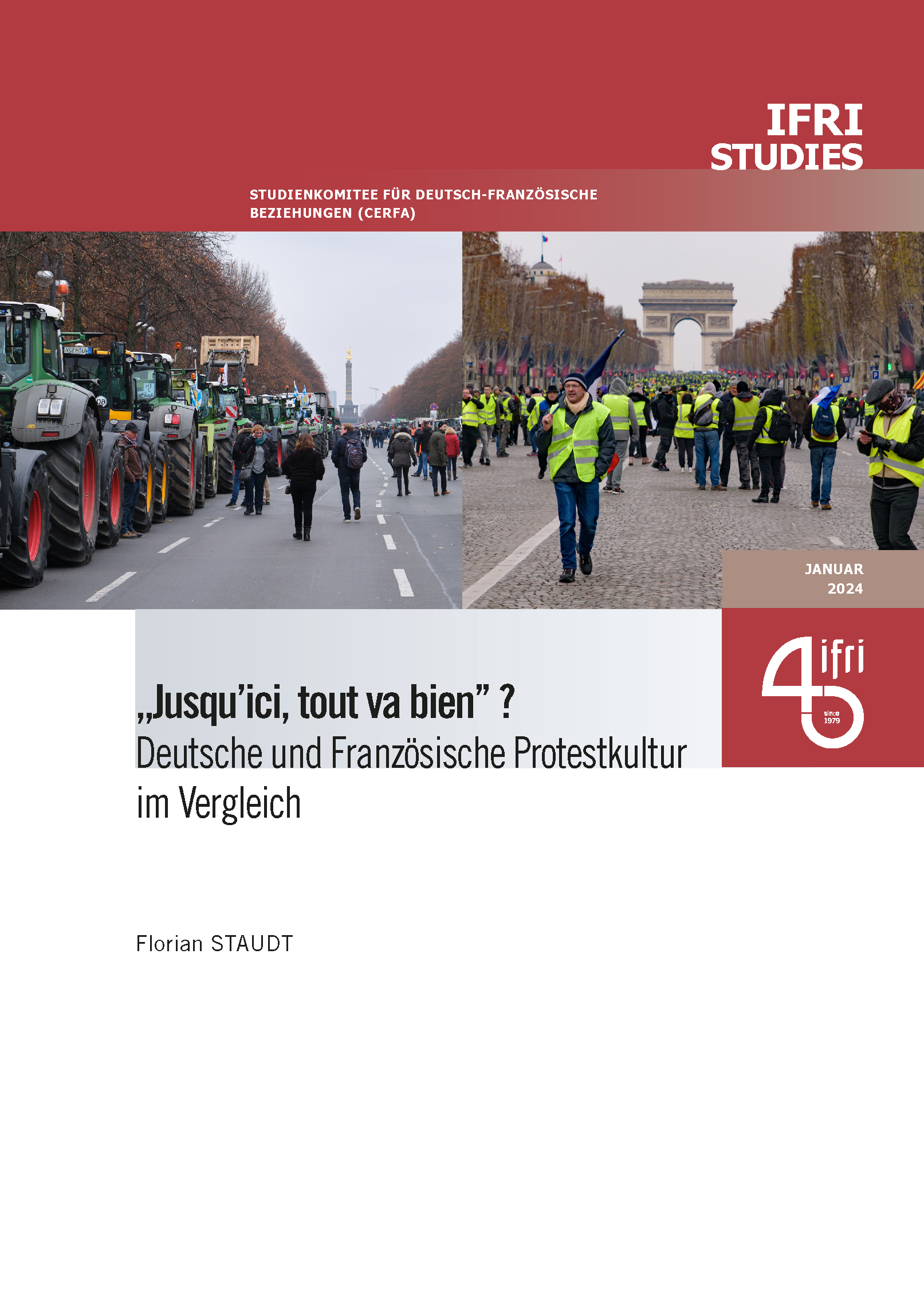
Der Einfluss unterschiedlicher Protestkulturen in Deutschland und Frankreich auf die Demokratie ist vielschichtig. Protest nimmt dafür verschiedene Formen an und dient als politische Repräsentation sowie Beitrag zur politischen Willensbildung.

Die Protestkulturen in Deutschland und Frankreich sind aufgrund unterschiedlicher Muster nur bedingt miteinander vergleichbar. Dennoch lassen sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen. Auf der einen Seite dominierten früher in beiden Ländern Gewerkschaften und politische Parteien die Protestlandschaft während heute Menschen verschiedener sozialer Schichten teilnehmen. Trotz einer deutlichen Überrepräsentation hoher Bildungsniveaus spiegeln Protestbewegungen in Deutschland und Frankreich heute ein breiteres gesellschaftliches Bild wider. Auch die Vielfalt der Protestthemen und die Bildung von politischen und sozialen Bewegungen reflektieren diesen Wandel. Auf deren Seite unterscheiden sich die Protestbewegungen in Deutschland und Frankreich in der Mobilisierungsstärke und Intensität der Proteste sowie in der Beeinflussung der Unzufriedenheit durch politische Systemfragen, wirtschaftliche Situation und soziale Strukturen.
Aktuell zeigt Deutschland Anzeichen für anhaltende oder steigende Protestbereitschaft, während in Frankreich zwar die Zahl der Demonstrationen abnimmt, dafür aber ein hoher Mobilisierungsgrad für einzelne Proteste erzielt wird. Insbesondere die Gelbwesten-Bewegung in Frankreich hat zuletzt eine breitere Diskussion über soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Ungleichheit, Umweltfragen und das Ende der repräsentativen Demokratie ausgelöst. Es stellt sich die Frage, ob die zunehmende Intensität der Proteste auf eine allgemeine Unzufriedenheit und Demokratiekrise hinweist oder eher auf gesteigerte bürgerliche Mitverantwortung.
Florian Staudt ist Europawissenschaftler und spezialisiert auf Deutsch-Französische Beziehungen sowie die europäische Integration.
Diese Publikation ist auf Frankreich verfügbar: « ‘‘Jusqu’ici, tout va bien’’ ? Analyse croisée des cultures contestataires en France et en Allemagne » (PDF).

Inhalte verfügbar in :
ISBN/ISSN
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Laden Sie die vollständige Analyse herunter
Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenfassung unserer Arbeit. Wenn Sie mehr Informationen über unserer Arbeit zum Thema haben möchten, können Sie die Vollversion im PDF-Format herunterladen.
"Jusqu’ici, tout va bien" ? Deutsche und Französische Protestkultur im Vergleich
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere VeröffentlichungenZwischen Vorstellung und gelebter Realität: die deutsch-französische Grenze als europäisches Zukunftslabor
In Europa ist die Frage der Grenzen alles andere als nebensächlich. Nach Angaben des Europäischen Parlaments umfassen die Grenzregionen rund 40 % des Territoriums der Europäischen Union (EU), beherbergen 30 % ihrer Bevölkerung und erwirtschaften nahezu ein Drittel ihres Bruttoinlandsprodukts.
Ein deutsch-französischer „Reset“? Die Ambitionen des deutsch-französischen Ministerrats - Herausforderungen einer gemeinsamen Führungsrolle in Europa.
Friedrich Merz ist als rheinischer Katholik ein Erbe der deutsch-französischen Politik der CDU, von Konrad Adenauer über Wolfgang Schäuble bis hin zu Helmut Kohl. Auch wenn die deutsch-französische Rhetorik und Denkweise bei ihm tief verwurzelt sind, muss man ihre Ergebnisse dennoch relativieren.
Sozialpolitik in Deutschland: Bilanz der Ampelkoalition und Perspektiven der neuen Regierung
Notes du Cerfa, N0. 188, Ifri, Juli 2025 — Die Niederlage der „Ampel-Koalition“ bei den vorgezogenen Bundestagsswahlen im Februar 2025 lädt zu einer ersten, notwendigerweise selektiven Bilanz der im Laufe ihrer Amtszeit durchgeführten Sozialpolitik ein.
Deutsch-französische Diagnosen
Ein zu allem entschlossener Imperialist im Kreml, ein unsicherer Kantonist im Weißen Haus: Die Zeiten für Europa waren schon mal besser. Wie können Paris und Berlin gemeinsam gegensteuern, welche Rolle spielen die Thinktanks beider Länder?