Deutsch-französische Diagnosen
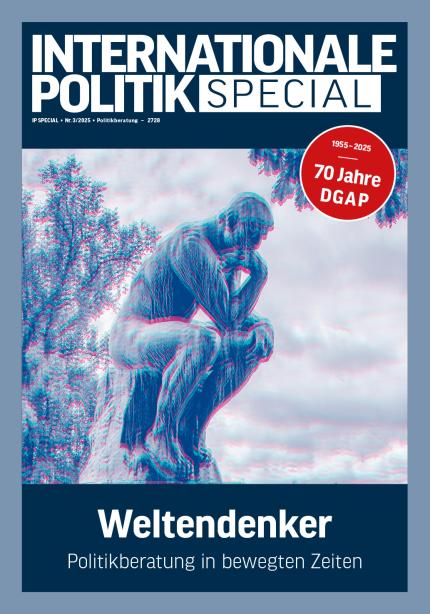
Ein zu allem entschlossener Imperialist im Kreml, ein unsicherer Kantonist im Weißen Haus: Die Zeiten für Europa waren schon mal besser. Wie können Paris und Berlin gemeinsam gegensteuern, welche Rolle spielen die Thinktanks beider Länder?
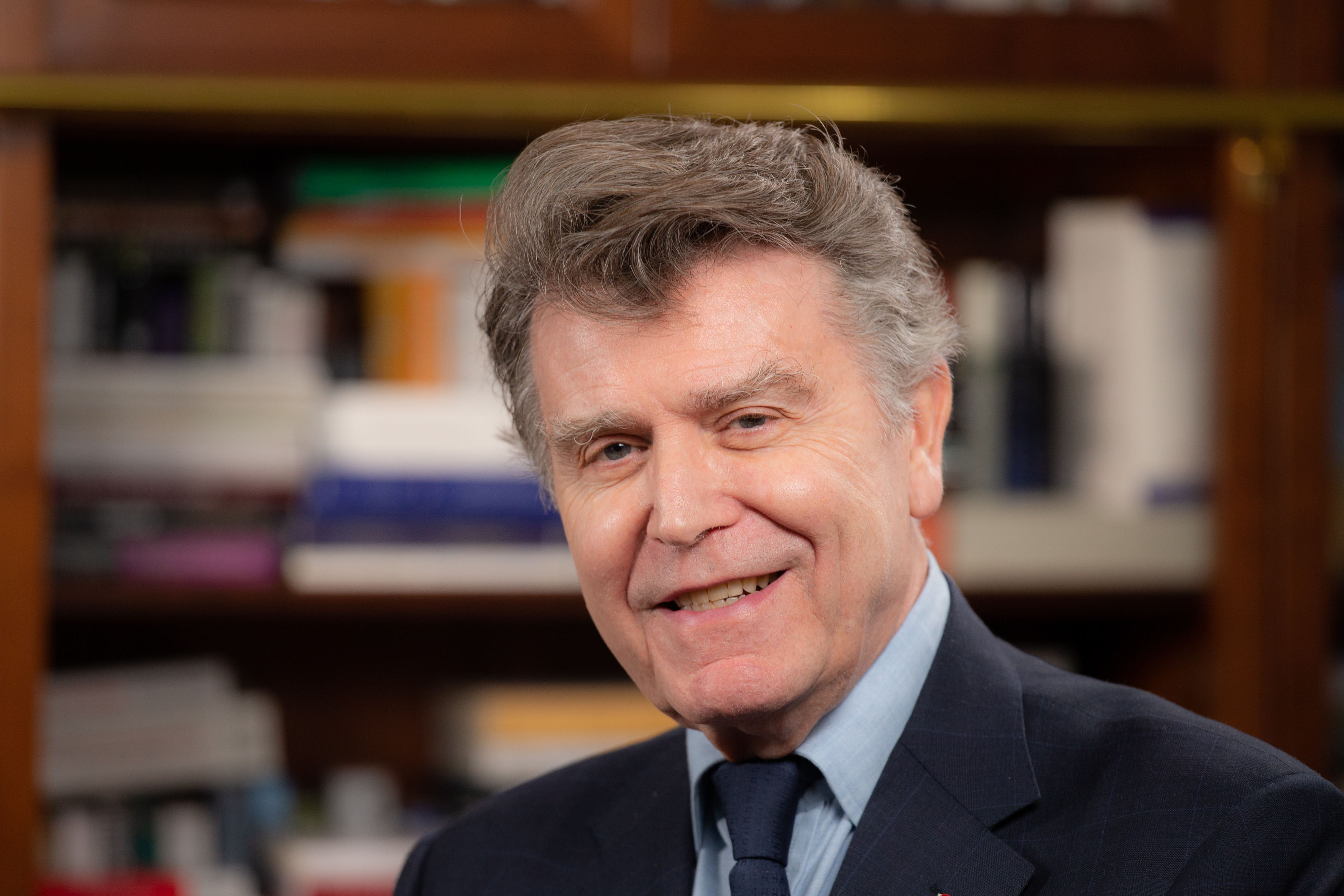
Wird es die Europäische Union zur Mitte dieses Jahrhunderts noch geben? Sicher ist das nicht. Genauso wenig können wir mit Bestimmtheit vorhersagen, ob sie keine hundert Jahre alt wird, bevor sie untergeht. Fest steht nur eines: Die EU ist in ihrem Fortbestand bedroht.
Das liegt, erstens, an den Spätfolgen des Zerfalls der Sowjetunion, zweitens am Aufstieg Asiens und insbesondere Chinas. Der dritte Grund ist der Beginn einer neuen Ära in den USA, die von aggressivem Konservatismus, der Rückkehr zum Protektionismus und einer Tendenz zur Neuaufteilung der Welt in Einflusszonen geprägt ist.
Wäre es nicht Mitte des vergangenen Jahrhunderts gelungen, die Idee der deutsch-französischen Aussöhnung zu konkretisieren, wäre die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft nie entstanden. Ebenso gilt für die kommenden 25 Jahre, dass die Europäische Union ihre Versprechungen nur dann wird einlösen können, wenn Deutschland und Frankreich über eine lange Zeit hinweg – das ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit – einen gemeinsamen Willen demonstrieren, die Hindernisse auf diesem Weg zu überwinden.
Das ist jedoch alles andere als selbstverständlich. Sollten sich die Wege Deutschlands und Frankreichs mittelfristig trennen, wären der Zerfall oder vielleicht sogar die Spaltung der EU besiegelt. Was wären die wirtschaftlichen und geopolitischen Folgen? Anlässlich des 70. Jubiläums der DGAP müssen wir dringender denn je darüber nachdenken, wie Frankreich und Deutschland, besonders mithilfe ihrer Thinktanks, dazu beitragen können, eine solche Entwicklung zu verhindern.
Wenn unsere Länder die Zukunft solide gestalten wollen, müssen sie sich zunächst auf eine klare gemeinsame Diagnose verständigen. Sie müssen den Mut haben, alle Szenarien ehrlich durchzuspielen, die sich ergeben, wenn man den derzeit innerhalb der EU und ihrem Umfeld wirkenden wirtschaftlichen, politischen und militärischen Kräften ihren Lauf lässt.
Begegnung mit Karl Kaiser
Zunächst einmal ist es wichtig zu begreifen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Plan, aus dem die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft entstehen sollte, amerikanischen wie europäischen Ursprungs war. Das hatte zwei Folgen: Auf politischer Ebene unterstellte sich Westeuropa dem Schutz der USA. Das galt sogar für das gescheiterte Projekt einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG). Und auf wirtschaftlicher Ebene wurde Europas Wiederaufbau unter dem Dach der Bretton-Woods-Institutionen geplant, die dank amerikanischer Führung aufgebaut wurden.
Von da an – und während der gesamten vier Jahrzehnte, die zwischen der Gründung des Nordatlantikpakts und dem Fall der Berliner Mauer lagen – hielten die USA unverrückbar an der Doktrin fest, dass Amerika und Europa angesichts der sowjetischen Bedrohung eine Schicksalsgemeinschaft bildeten. In Kontinentaleuropa bewahrte sich nur Frankreich eine langfristige Perspektive der Geschichte und setzte auf eine ergebnisoffene strategische Reflexion, auch wenn seine Mittel relativ bescheiden waren.
Auf diesem Weg markierte das Jahr 1973 mit der ersten Erweiterung der Europäischen Gemeinschaft (EG) um Dänemark, Irland und das Vereinigte Königreich einen Richtungswechsel. Der Beitritt Großbritanniens veränderte das Gleichgewicht des politischen Systems der Gemeinschaft radikal. Doch der europäischen Wirtschaft ging es immer noch gut. Und: In den Ost-West-Beziehungen war die Zeit der Entspannung angebrochen.
1973 war auch das Jahr meiner ersten Begegnung mit Karl Kaiser, der gerade die Leitung des Forschungsinstituts der DGAP übernommen hatte, kurz bevor das Centre d’Analyse et de Prévision (CAP) des französischen Außenministeriums gegründet wurde, dessen erster Direktor ich wurde. Das CAP war das Gegenstück zum Planungsstab des Auswärtigen Amtes und dem Policy Planning Staff des US-Außenministeriums.
- Im völlig neuen Kontext der 1990er Jahre stellte sich die Frage nach einer Auflösung der NATO
Wir begannen sofort zusammenzuarbeiten, in der gemeinsamen Überzeugung, dass Europäische Gemeinschaft und NATO die zwei Säulen eines dauerhaften Friedens auf unserem Kontinent waren. Karl Kaisers Wirken an der Spitze der DGAP, die er zu einem der wichtigsten, wenn nicht sogar zum einzigen echten Thinktank jener Zeit in Kontinentaleuropa machte, half mir, Deutschland als politische Macht besser zu verstehen. Dass es in der DGAP ein Forschungszentrum zu Frankreich gab, war Ausdruck unserer Überzeugung, dass das, was wir deutsch-französischen „Motor“ oder „Paar“ nannten, der Schlüssel zur Stabilität auf unserem Kontinent ist.
Nachdem ich Anfang 1979 das Institut français des relations internationales (Ifri) ins Leben gerufen hatte, waren Karl Kaiser und ich uns einig, unsere Zusammenarbeit über das schon länger bestehende Comité d’études des relations franco-allemandes hinaus auszuweiten. Wir hielten den Dialog auch mit anderen europäischen Thinktanks für unerlässlich, um unsere Aufgabe der „Politikberatung“ in einem internationalen Rahmen zu verorten.
Wir begründeten eine Jahrestagung von Politikern, Wirtschaftsvertretern, Forschern und Journalisten, die abwechselnd in Paris und Bonn stattfand. Anfangs ahnten wir nicht, dass das internationale System mit der Islamischen Revolution im Iran und der sowjetischen Invasion Afghanistans vor dem Umbruch stand. Zu dieser Zeit begann auch die Diskussion um die NATO-Nachrüstung, die ein gutes Beispiel dafür ist, welche Rolle Thinktanks bei der Strukturierung von Debatten spielen.
Angesichts derart grundlegender Veränderungen des internationalen Umfelds hatten Karl Kaiser und ich die Idee zu einem Projekt, aus dem der sogenannte Vier-Direktoren-Bericht „Die Sicherheit des Westens: Neue Dimensionen und Aufgaben“ (1981) hervorging. Beteiligt waren die DGAP, der Council on Foreign Relations in New York (CFR), das Ifri und das Royal Institute of International Affairs (Chatham House). Uns ging es darum, zu einer gemeinsamen Diagnose und gemeinsamen Empfehlungen für die transatlantischen Beziehungen zu kommen.
In dem Bericht betonten wir die Notwendigkeit eines umfassenden Sicherheitsbegriffs für den Westen und einer Zusammenarbeit der NATO mit der damals sogenannten Dritten Welt. Unser Konzept der Kooperation hat beachtliche Erfolge erzielt, auch unter der später im anderen Kontext bekanntgewordenen Bezeichnung „Koalition der Willigen“.
Dieser erste Erfolg ermutigte uns, zwei Jahre später ein ähnliches Projekt zur Zukunft der Europäischen Gemeinschaft in Angriff zu nehmen. Wieder waren DGAP, Ifri und Chatham House dabei, ebenso das Istituto Affari Internazionali. Für die Niederlande nahm Edmund Wellenstein teil, bekannt wegen seiner großen Erfahrung in der EG-Politik. Wir waren schon damals der Meinung, dass die Gemeinschaft vor existenzgefährdenden Problemen stehe. Auch dieser Bericht, veröffentlicht unter dem Titel „Die EG vor der Entscheidung: Fortschritt oder Verfall“ (1983), war ein Erfolg.
Kein Ende der Geschichte
Auf den Fall der Berliner Mauer und den Zerfall der Sowjetunion war keiner von uns vorbereitet. In den großen Thinktanks führten diese Ereignisse zu der Überlegung, unsere Beziehungen zu den Schwellenländern zu stärken, vor allem zu den großen Ländern wie China und Indien. Aber natürlich auch zu Russland.
Im völlig neuen Kontext der 1990er Jahre stellte sich die Frage einer möglichen Auflösung der NATO und der Errichtung einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur. Dieser Weg wurde nicht gewählt. Stattdessen ging der Westen auf die Bestrebungen der ehemaligen „Satellitenstaaten“ Mittel- und Osteuropas ein, die diese Gelegenheit nutzen wollten, um die russische Frage ein für alle Mal in ihrem Sinne zu lösen. Zu ihrem Vorteil wurden EG und NATO überstürzt erweitert. Die Priorität der westlichen Länder bestand darin, den Aufbau der Demokratie in Russland zu unterstützen, einen noch sehr fragilen Prozess, von dem man aber glauben wollte, er sei unausweichlich und unumkehrbar. Warnungen aus Moskau vor einer NATO-Erweiterung wurden ignoriert.
Zur Jahrtausendwende wünschte sich die gesamte Bevölkerung der Russischen Föderation nichts sehnlicher als einen starken Mann. Dieser Mann war ein gewisser Wladimir Putin. Aber auch wenn die Beziehungen zwischen ihm und dem Westen schon Anfang der 2000er Jahre von gegenseitigem Misstrauen geprägt waren, konnte man noch zuversichtlich in die Zukunft blicken, ohne völlig naiv zu sein. Erst nach der „Orangenen Revolution“ in der Ukraine 2004 tat sich eine Kluft auf, die immer tiefer wurde. Vielleicht haben die großen europäischen Thinktanks unterschätzt, wie weit die Idee vom „Ende der Geschichte“ von der Wirklichkeit abwich. Mit dieser Idee ging in vielen westlichen Ländern der Gedanke einher, dass so etwas wie Regime Change zulässig sei – nicht nur bei den US-Neokonservativen.
Dieses Scheitern haben viele mitzuverantworten, und die Frage nach den Ursachen ist weit mehr als ein Streit unter Historikern: Sie stellt sich heute jedem, der sich Gedanken über die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Russland macht. Ob man den Krieg in der Ukraine als Folge des Scheiterns am Ende des Kalten Krieges oder als Folge des Revanchismus von Wladimir Putin sieht – er hat eine EU, die das geopolitische Modell Polens, der Ukraine und der baltischen Staaten übernommen hat, erschüttert und geschwächt. Noch allerdings ist diese Entwicklung nicht unwiderruflich. Deutschland und Frankreich sind in keiner Weise dazu verpflichtet, ohne gründliche Prüfung auf Dauer das geopolitische Modell der drei Genannten zu übernehmen. Die USA haben sich bereits davon distanziert.
Erneut in die Falle getappt
Der dritte Teil der Diagnose betrifft den Aufstieg Chinas und anderer Länder des Globalen Südens. Am Ende des 20. Jahrhunderts hatten die Amerikaner bereits verstanden, welche Gefahren diese Entwicklung für ihre Vormachtstellung barg. Doch der Zeitgeist war geprägt von der Globalisierung und ihren kurzfristigen Vorteilen: Verlagerung der Produktion zur Kostenminimierung, Ausweitung der Absatzmärkte.
Diese Globalisierung führte zu einer langen Phase des Wohlstands. Was der Westen anfangs nicht sah oder nicht sehen wollte, war, dass China, ein Land mit einer großen Zivilisation, es nicht beim Austausch von Waren und Dienstleistungen gegen Arbeit belassen würde. Tatsächlich wurde der freie Handel de facto zu einem gigantischen Technologietransfer zugunsten Chinas. Schneller als erwartet wurde das Land zu einer globalen Macht, die in der Lage war, den Westen herauszufordern.
Wie im Fall Russlands tappten wir erneut in die Falle, an die unausweichliche Ausbreitung der Demokratie zu glauben. Darüber hinaus haben wir wohl die Fähigkeit der Chinesen unterschätzt, langfristig zu denken, gerade im Hinblick auf Taiwan.
- Die erst seit Kurzem wieder unabhängigen EU-Staaten sind eher von nationalen Interessen getrieben als vom Traum der Gründerväter
Und dann ist da noch die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus. Seine politische Linie ist weniger sprunghaft als sie scheint. Einerseits wendet sich Trump von einer geopolitischen Vision à la Zbigniew Brzeziński ab, wonach die Herrschaft über den eurasischen Kontinent von der Kontrolle über die Ukraine abhängt. Auch Trump wird wohl davon ausgehen, dass die Ukraine, auch wenn sie einen Teil ihres Territoriums von 1991 verlieren dürfte, überwiegend im westlichen Lager verbleiben wird – genauer gesagt, mindestens so sehr im Lager der USA wie dem der EU.
Angesichts dieser Prämisse zeigt Trump keinerlei Vorliebe für die ideologische Verbreitung der Demokratie, die ein Markenzeichen der amerikanischen Demokraten und Neokonservativen ist.
Andererseits glaubt Trump aus wirtschaftlichen und politischen Gründen, dass der Zeitgeist in Richtung der Schaffung von Einflusszonen geht. Damit sind wir wieder beim Aufstieg Chinas und eines Teiles des Globalen Südens. So erklärt sich auch Trumps Zolloffensive im Jahr 2025.
Vorbei sind die Zeiten des Dollars als einziger Reservewährung der Welt. In unserer Zeit sind Mächte aufgestiegen, die die Kolonialisierung ihrer Wirtschaft nicht akzeptieren und nach anderen Anlagemöglichkeiten für ihre Überschüsse suchen – außerhalb der USA. Die Welt bewegt sich auf ein System zu, das zunächst aus zwei Reservewährungen bestehen wird. Das macht es für uns verständlicher, dass die Amerikaner nun – ob mit oder ohne Trump – eine echte Lastenteilung mit den Verbündeten und mehr Investitionen von ihnen in den USA erwarten. Aus dieser Perspektive ist der Zollkrieg Mittel und Zweck zugleich.
Die erste Aufgabe im Hinblick auf eine Neubegründung der deutsch-französischen Beziehungen besteht darin, sich wirklich auf eine Diagnose des internationalen Systems und der EU zu einigen. Denn die Union ist heute ein immer heterogenerer und damit fragiler werdender Verbund. Die Staaten, die erst vor Kurzem ihre Unabhängigkeit wiedererlangt haben, lassen sich eher von ihren eigenen nationalen Interessen treiben als von dem Traum der Gründerväter. Man kann sie verstehen.
Der Fortbestand der Eurozone hängt davon ab, ob die Bedingungen erfüllt sind, die für die Lebensfähigkeit einer idealen Währungszone gelten – und das in einem Umfeld, in dem der politische Wille nicht unbedingt auf lange Sicht gewährleistet ist. In dieser Hinsicht ist die französische Verantwortung vielleicht sogar noch größer als die auf deutscher Seite.
Merz als Chance?
Ist der Antritt einer neuen Regierung unter der Führung von Friedrich Merz eine Chance, die deutsch-französischen Beziehungen zugunsten Europas neu zu gestalten? Mit der im März 2025 verabschiedeten Reform der Schuldenbremse hat der neue Bundeskanzler eine Erhöhung der Militärausgaben ermöglicht, um seine Armee zu modernisieren.
Auf der Ebene der Sicherheit kann Deutschland jedoch aufgrund seiner Geschichte und seines besonderen Verhältnisses zu seinen Streitkräften nicht allein handeln. Der Bundeskanzler und der französische Staatspräsident haben bei Merz’ Besuch am 7. Mai in Paris vorgeschlagen, den Deutsch-Französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat (DFVSR) regelmäßiger zu Fragen der Strategie, der Verteidigung und der nationalen Sicherheit einzuberufen. Das soll es kurz- bis mittelfristig ermöglichen, die Unterstützung für die Ukraine, die Planung und Produktion im Verteidigungsbereich, die strategischen Verteidigungsziele sowie die bevorstehenden Revisionen der nationalen Strategien Frankreichs und Deutschlands zu koordinieren. Außerdem erklärte Merz, er wünsche sich eine entschlossenere Haltung gegenüber Russland und China – ein Bruch mit gewissen Ambivalenzen der Vergangenheit. Deutschland wird in enger Zusammenarbeit mit Frankreich seine strategische Position innerhalb der EU und der NATO klären müssen.
Selbst wenn es nur um die Entwicklung einer europäischen Rüstungsindustrie ginge, wäre das ein wirtschaftlich und politisch ambitioniertes Vorhaben
Mit der Rückkehr der CDU ins Auswärtige Amt und der Schaffung eines Nationalen Sicherheitsrats will der Kanzler die deutsche Außenpolitik kohärenter gestalten und dafür sorgen, dass sie weniger stark durch koalitionsinterne Kompromisse geprägt wird. Die Zerwürfnisse, die in der jüngsten Vergangenheit durch die mangelnde Kohärenz des „German vote“ in Brüssel entstanden sind, haben zu Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland geführt. Eine größere Kohärenz der deutschen Europapolitik würde es beiden Ländern ermöglichen, eine Art von gemeinsamem Leadership in Europa zu übernehmen, dessen Ausgestaltung allerdings noch zu klären ist.
Die Festigung der deutsch-französischen Beziehungen ist eine notwendige – aber nicht hinreichende – Voraussetzung für das Überleben des europäischen Projekts. Selbst wenn es nur um die Entwicklung einer europäischen Rüstungsindustrie ginge, die ein breites Spektrum abdeckt und technologisch anspruchsvoll ist, wäre das ein wirtschaftlich und politisch ambitioniertes Vorhaben. Eine solche Industrie müsste im globalen Kontext des Wettrüstens bestehen können. Die zwischenstaatliche Zusammenarbeit ist in diesem Bereich generell schwierig; es kommen auch noch Differenzen hinzu, was die Bedingungen für Rüstungsverkäufe außerhalb der EU betrifft. Und: Im Dienst welcher EU-Behörden und zur Abwehr welcher Risiken oder Bedrohungen soll die Industrie stehen?
Die gemeinsame Verteidigungsindustrie, wie sie ursprünglich konzipiert wurde, ist im Übrigen nicht strikt an die EU gebunden. Großbritannien wird beteiligt sein, das historisch gesehen eine andere geopolitische Vision hat als der Kontinent. Man wird zumindest zwischen der Aufrüstung im Rahmen der NATO und der außerhalb dieses Rahmens unterscheiden müssen. Würde es dann um ein von der NATO abgekoppeltes Bündnis zwischen europäischen Ländern – ob EU-Mitglieder oder nicht – gehen, das eigene strategische Konzepte, Befehlsketten, Geheimdienstkapazitäten etc. hat?
All das sind ausgesprochen komplexe Fragen, zumal die Europäische Union keinen oder keinen natürlichen Anführer mehr hat, es keine echte gemeinsame Außenpolitik gibt und der Begriff des vitalen europäischen Interesses jenseits von situativen Erklärungen sehr vage bleibt – außer in Extremfällen. In jedem Fall folgt die Industrie ihrer eigenen Logik, und die Einführung eines echten europäischen Wiederaufrüstungsplans muss auf einer wirklich gemeinsamen, langfristigen geopolitischen Vision beruhen.
- Es liegt an der DGAP und dem Ifri, gemeinsam einen Beitrag zum anstehenden Wiederaufbau zu leisten
Diese muss insbesondere mit einer gemeinsamen langfristigen Strategie sowohl gegenüber den USA als auch gegenüber Russland und China einhergehen. Davon sind wir noch weit entfernt. Auch die „willigen“ europäischen Staaten müssen lernen oder wieder lernen, strategisch zu denken. Im Nuklearbereich etwa konnte das Wissen der Strategen, das während des Kalten Krieges angesammelt wurde, nicht bewahrt werden, ebenso wenig in der Rüstungskontrolle.
[...]
Thierry de Montbrial ist Gründer und Vorstandsvorsitzender des französischen Instituts für Internationale Beziehungen (Ifri) in Paris.
Dieser Artikel erschien in der Sonderausgabe "Weltendenker. Politikberatung in bewegten Zeiten" von Internationale Politik Special 3, Juni 2025, S. 11-17.

Inhalte verfügbar in :
ISBN / ISSN
DOI
Internationale Politik Special 3, Juni 2025
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere Veröffentlichungen
Deutsch-französische Impulse für eine europäische Verteidigungspolitik – zwischen Gestaltungsanspruch und Defiziten
Mehr als 60 Jahre nach dem Élysée-Vertrag und sieben Jahre nach dem Vertrag von Aachen bleibt das deutsch-französische Tandem ein zentraler Machtfaktor innerhalb der Europäischen Union. Beide Länder bündeln einen erheblichen Teil des europäischen Bruttoinlandsprodukts, der industriellen Kapazitäten und der politischen Gestaltungsmacht. Gleichzeitig ist das Kräfteverhältnis im Jahr 2026 asymmetrischer geworden. Deutschland tritt unter Kanzler Friedrich Merz selbstbewusst als finanz- und sicherheitspolitisches Schwergewicht auf, während Frankreich politisch geschwächt ist.
Merz' Europapolitik: das Ende vom "German vote"?
Friedrich Merz’ Ziel ist es, Deutschland von der oft zögerlichen Rolle der vergangenen Jahre zu einem klar erkennbaren Gestaltungsakteur in der Europäischen Union zu machen, der seine Verantwortung für die europäische Integration offensiv wahrnimmt. Kern dieses Anspruchs ist das Versprechen, den „German vote“ zu überwinden – also jene Konstellationen, in denen Deutschland aufgrund innerstaatlicher Abstimmungsprobleme in Brüssel keine eindeutige Position bezieht und so die europäische Entscheidungsfindung blockiert.
Zwischen Vorstellung und gelebter Realität: die deutsch-französische Grenze als europäisches Zukunftslabor
In Europa ist die Frage der Grenzen alles andere als nebensächlich. Nach Angaben des Europäischen Parlaments umfassen die Grenzregionen rund 40 % des Territoriums der Europäischen Union (EU), beherbergen 30 % ihrer Bevölkerung und erwirtschaften nahezu ein Drittel ihres Bruttoinlandsprodukts.
Ein deutsch-französischer „Reset“? Die Ambitionen des deutsch-französischen Ministerrats - Herausforderungen einer gemeinsamen Führungsrolle in Europa.
Friedrich Merz ist als rheinischer Katholik ein Erbe der deutsch-französischen Politik der CDU, von Konrad Adenauer über Wolfgang Schäuble bis hin zu Helmut Kohl. Auch wenn die deutsch-französische Rhetorik und Denkweise bei ihm tief verwurzelt sind, muss man ihre Ergebnisse dennoch relativieren.








