Deutsch-französische Fraternisierungen in Kriegszeiten. Interdisziplinäre Ansätze zu den Fraternisierungen in den neuzeitlichen deutsch-französischen Konflikten (1799–1945)
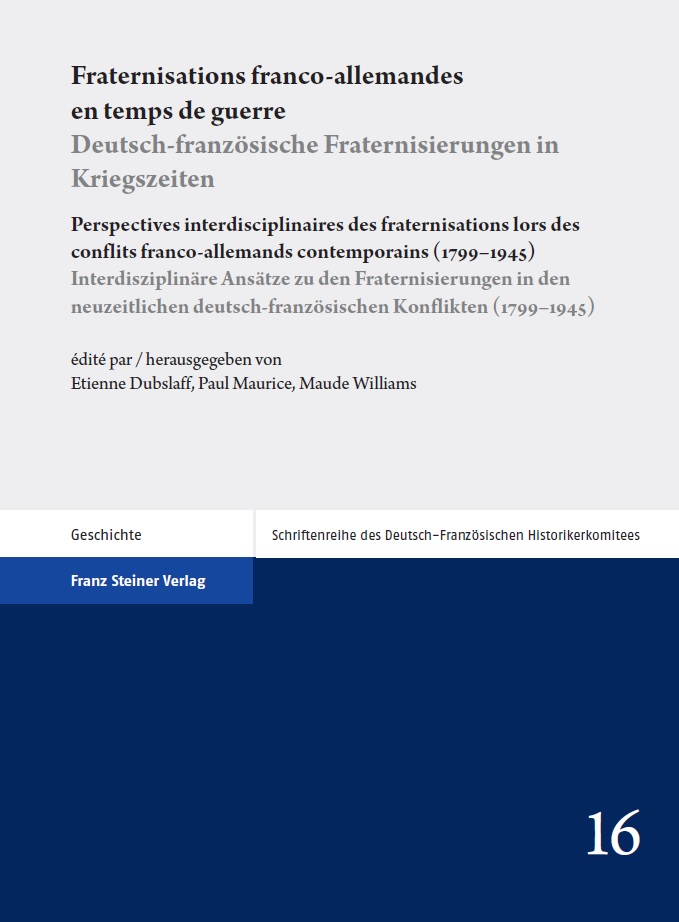
Von den napoleonischen Kriegen im 19. Jahrhundert bis hin zu den zwei Weltkriegen des 20. Jahrhunderts führten Deutschland und Frankreich immer wieder Krieg gegeneinander.
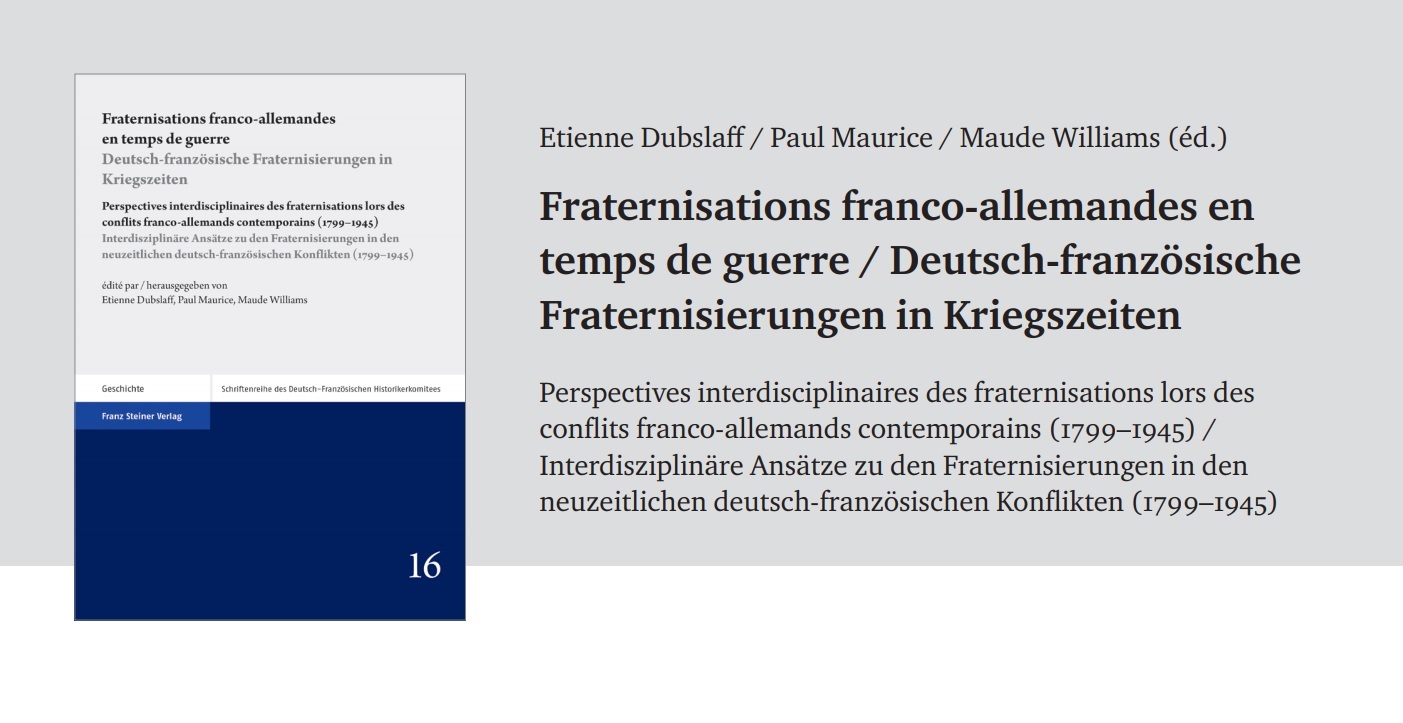
Die damit einhergehenden menschlichen Begegnungen waren von Gewalt und Zerstörung geprägt – dementsprechend werden in der Historiographie Kriege und Besatzungszeiten vornehmlich als Momente der Gewalt untersucht, seit einigen Jahren aber auch als Momente des kulturellen Austausches. Den Fraternisierungen zwischen den Soldaten verfeindeter Armeen oder zwischen Soldaten und der besetzten Bevölkerung schenkte die Forschung bisher jedoch nur unzureichend Beachtung. Dabei bilden sie einen wichtigen Aspekt der deutsch-französischen Kriege: Sie zeugen von Begegnungen, die trotz der kriegerischen Umstände und der strafrechtlichen, geographischen, sprachlichen und psychischen Hindernisse nicht nur gewalttätig, sondern auch pazifistischer und freundschaftlicher Natur waren. In ihren Beiträgen untersuchen die Autorinnen und Autoren das Phänomen der Fraternisierung, seine Charakteristika, Mechanismen und Ausdrucksformen auf sozialer, politischer, historischer und kultureller Ebene. Auch die künstlerische Darstellung und die Erinnerung an die Fraternisierungen spielen dabei eine zentrale Rolle.
Etienne Dubslaff, Paul Maurice, Maude Williams (Hrsg.), Fraternisations franco-allemandes en temps de guerre / Deutsch-französische Fraternisierungen in Kriegszeiten. Perspectives interdisciplinaires des fraternisations lors des conflits franco-allemands contemporains (1799–1945) / Interdisziplinäre Ansätze zu den Fraternisierungen in den neuzeitlichen deutsch-französischen Konflikten (1799–1945), Stuttgart, Steiner Verlag, 2019, 270 S. Verfugbar.

Inhalte verfügbar in :
ISBN/ISSN
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere Veröffentlichungen
Deutsch-französische Impulse für eine europäische Verteidigungspolitik – zwischen Gestaltungsanspruch und Defiziten
Mehr als 60 Jahre nach dem Élysée-Vertrag und sieben Jahre nach dem Vertrag von Aachen bleibt das deutsch-französische Tandem ein zentraler Machtfaktor innerhalb der Europäischen Union. Beide Länder bündeln einen erheblichen Teil des europäischen Bruttoinlandsprodukts, der industriellen Kapazitäten und der politischen Gestaltungsmacht. Gleichzeitig ist das Kräfteverhältnis im Jahr 2026 asymmetrischer geworden. Deutschland tritt unter Kanzler Friedrich Merz selbstbewusst als finanz- und sicherheitspolitisches Schwergewicht auf, während Frankreich politisch geschwächt ist.
Merz' Europapolitik: das Ende vom "German vote"?
Friedrich Merz’ Ziel ist es, Deutschland von der oft zögerlichen Rolle der vergangenen Jahre zu einem klar erkennbaren Gestaltungsakteur in der Europäischen Union zu machen, der seine Verantwortung für die europäische Integration offensiv wahrnimmt. Kern dieses Anspruchs ist das Versprechen, den „German vote“ zu überwinden – also jene Konstellationen, in denen Deutschland aufgrund innerstaatlicher Abstimmungsprobleme in Brüssel keine eindeutige Position bezieht und so die europäische Entscheidungsfindung blockiert.
Zwischen Vorstellung und gelebter Realität: die deutsch-französische Grenze als europäisches Zukunftslabor
In Europa ist die Frage der Grenzen alles andere als nebensächlich. Nach Angaben des Europäischen Parlaments umfassen die Grenzregionen rund 40 % des Territoriums der Europäischen Union (EU), beherbergen 30 % ihrer Bevölkerung und erwirtschaften nahezu ein Drittel ihres Bruttoinlandsprodukts.
Ein deutsch-französischer „Reset“? Die Ambitionen des deutsch-französischen Ministerrats - Herausforderungen einer gemeinsamen Führungsrolle in Europa.
Friedrich Merz ist als rheinischer Katholik ein Erbe der deutsch-französischen Politik der CDU, von Konrad Adenauer über Wolfgang Schäuble bis hin zu Helmut Kohl. Auch wenn die deutsch-französische Rhetorik und Denkweise bei ihm tief verwurzelt sind, muss man ihre Ergebnisse dennoch relativieren.








