Das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Gesetzgeberische Motive, Aufbau und erste Erfahrungen
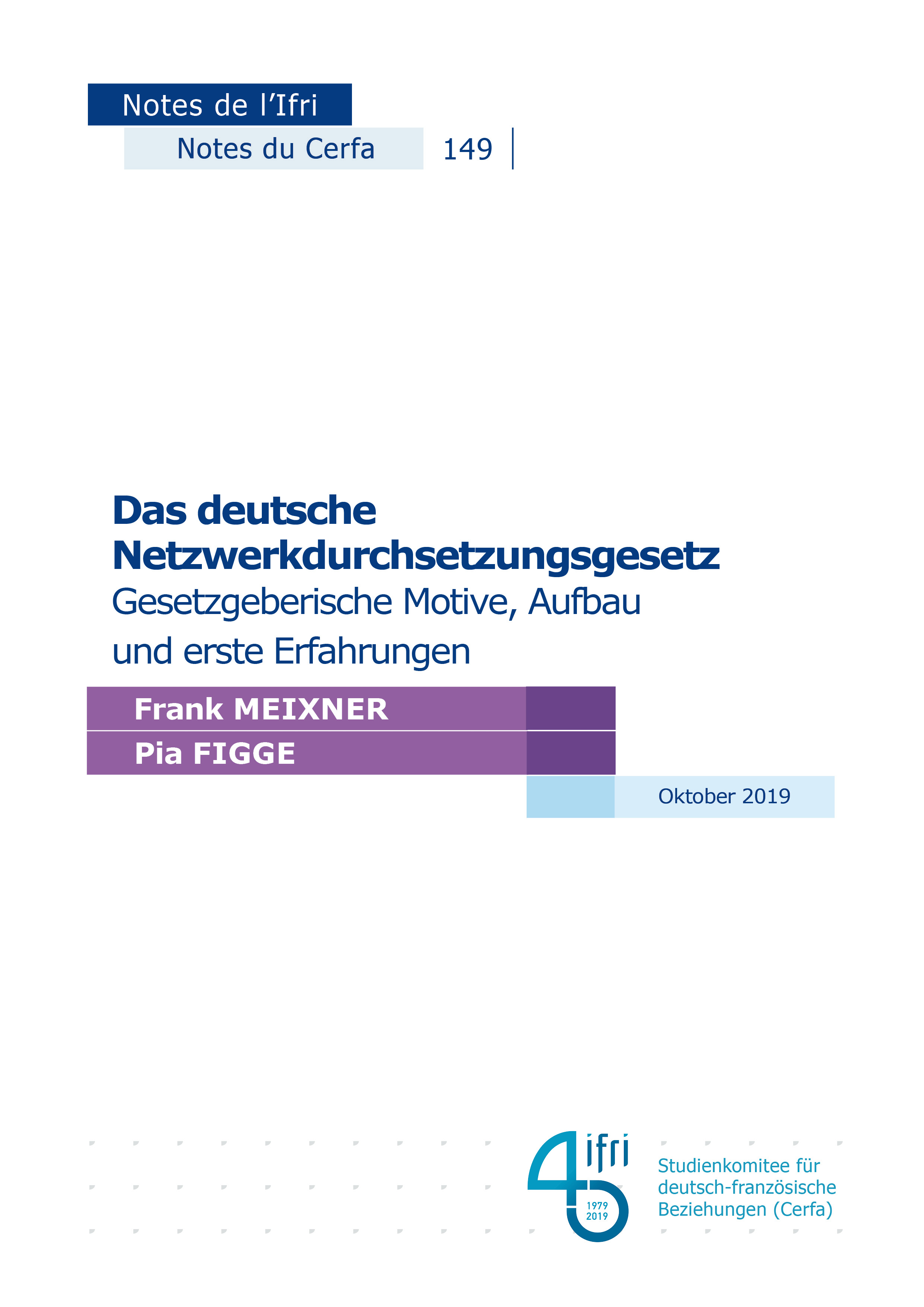
Das deutsche Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz - NetzDG), in Kraft getreten am 1. Oktober 2017, ist die gesetzgeberische Reaktion auf den Umgang sozialer Netzwerke mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte.

Wie der Name des Gesetzes „Verbesserung“ der Rechtsdurchsetzung bereits besagt, geht es nicht um die Implementierung neuer Pflichten, sondern um die Durchsetzung bestehenden Rechts. Ziel ist das zeitnahe Entfernen rechtswidriger Inhalte aus dem Netz. Hierzu werden Compliance-Pflichten zum Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte in sozialen Netzwerken mit mehr als zwei Millionen registrierten Nutzern im Inland normiert. Um entsprechende Inhalte, deren Strafbarkeit am Maßstab des deutschen Strafrechts zu bewerten sind, nicht nur unter Strafe zu stellen, sondern auch aus den sozialen Netzwerken zu entfernen, wurde das NetzDG erlassen. Dem NetzDG liegt das deutsche Ordnungswidrigkeitenrecht als Konzept zugrunde. Zuständige Verfolgungsbehörde ist das Bundesamt für Justiz, eine Bundesoberbehörde mit Sitz in Bonn. Im Fall von Verstößen gegen die Pflichten des NetzDG kann das Bundesamt für Justiz eine Geldbuße verhängen. Das Bundesamt für Justiz ist in seiner Funktion nach dem NetzDG eine reine Verfolgungsbehörde und hat keine Aufsichts- oder regulatorischen Kompetenzen – im Gegensatz etwa zu den Landesmedienanstalten.
In dieser Studie werden die Motive des deutschen Gesetzgebers, der Aufbau des Gesetzes und seine Umsetzung durch das Bundesamt für Justiz erläutert. Abschließend wird auf erste Erfahrungen mit den Pflichten des NetzDG eingegangen.
Regierungsdirektor Frank Meixner ist Leiter des Referats für Grundsatzfragen und Verfahrensentwicklung der Abteilung VIII (Netzwerkdurch-setzungsgesetz; Verbraucherschutz) im Bundesamt für Justiz in Bonn.
Regierungsrätin Pia Figge ist Referentin im Grundsatzreferat in der Abteilung VIII (Netzwerkdurchsetzungsgesetz; Verbraucherschutz) im Bundesamt für Justiz.
Diese Publikation ist auch auf Französisch "Réseaux sociaux : la lutte contre les contenus haineux en Allemagne" verfügbar.

Inhalte verfügbar in :
ISBN/ISSN
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Laden Sie die vollständige Analyse herunter
Auf dieser Seite finden Sie eine Zusammenfassung unserer Arbeit. Wenn Sie mehr Informationen über unserer Arbeit zum Thema haben möchten, können Sie die Vollversion im PDF-Format herunterladen.
Das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Gesetzgeberische Motive, Aufbau und erste Erfahrungen
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere Veröffentlichungen
Deutsch-französische Impulse für eine europäische Verteidigungspolitik – zwischen Gestaltungsanspruch und Defiziten
Mehr als 60 Jahre nach dem Élysée-Vertrag und sieben Jahre nach dem Vertrag von Aachen bleibt das deutsch-französische Tandem ein zentraler Machtfaktor innerhalb der Europäischen Union. Beide Länder bündeln einen erheblichen Teil des europäischen Bruttoinlandsprodukts, der industriellen Kapazitäten und der politischen Gestaltungsmacht. Gleichzeitig ist das Kräfteverhältnis im Jahr 2026 asymmetrischer geworden. Deutschland tritt unter Kanzler Friedrich Merz selbstbewusst als finanz- und sicherheitspolitisches Schwergewicht auf, während Frankreich politisch geschwächt ist.
Merz' Europapolitik: das Ende vom "German vote"?
Friedrich Merz’ Ziel ist es, Deutschland von der oft zögerlichen Rolle der vergangenen Jahre zu einem klar erkennbaren Gestaltungsakteur in der Europäischen Union zu machen, der seine Verantwortung für die europäische Integration offensiv wahrnimmt. Kern dieses Anspruchs ist das Versprechen, den „German vote“ zu überwinden – also jene Konstellationen, in denen Deutschland aufgrund innerstaatlicher Abstimmungsprobleme in Brüssel keine eindeutige Position bezieht und so die europäische Entscheidungsfindung blockiert.
Zwischen Vorstellung und gelebter Realität: die deutsch-französische Grenze als europäisches Zukunftslabor
In Europa ist die Frage der Grenzen alles andere als nebensächlich. Nach Angaben des Europäischen Parlaments umfassen die Grenzregionen rund 40 % des Territoriums der Europäischen Union (EU), beherbergen 30 % ihrer Bevölkerung und erwirtschaften nahezu ein Drittel ihres Bruttoinlandsprodukts.
Ein deutsch-französischer „Reset“? Die Ambitionen des deutsch-französischen Ministerrats - Herausforderungen einer gemeinsamen Führungsrolle in Europa.
Friedrich Merz ist als rheinischer Katholik ein Erbe der deutsch-französischen Politik der CDU, von Konrad Adenauer über Wolfgang Schäuble bis hin zu Helmut Kohl. Auch wenn die deutsch-französische Rhetorik und Denkweise bei ihm tief verwurzelt sind, muss man ihre Ergebnisse dennoch relativieren.






