Deutschlands Einsatz in Afghanistan: Die sicherheitspolitische Dimension
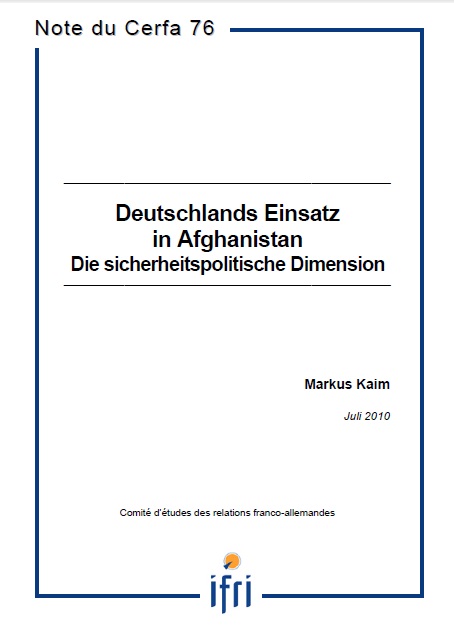
Bei der internationalen Afghanistan-Konferenz am 28. Januar 2010 sollten aus deutscher Sicht, die Ziele und Instrumente der internationalen Gemeinschaft, die für den Wiederaufbau des Landes eine Rolle spielen, auf den Prüfstand kommen. Dieses Bedürfnis resultierte im Falle Berlins aus der Einsicht, dass der Bundeswehreinsatz in Afghanistan nicht weiter gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung durchgesetzt werden kann.
Obgleich kein deutscher Politiker bislang ein offizielles Ende der deutschen ISAF-Mission öffentlich terminiert hat, so ist doch klar, dass Bundesregierung und Bundestag unausgesprochen auf den Zeitplan von Präsident Obama eingeschwenkt sind, vom Sommer 2011 an die nationalen ISAF-Kontingente aus Afghanistan sukzessive abzuziehen und die Verantwortung für die Sicherheit an die afghanischen Behörden zu übergeben.
Viel zu lange dominierte die Formulierung von vagen Zielen („islamistischen Terrorismus bekämpfen“, „Afghanistan demokratisieren“ u.a.m.) deren Realisierung letzlich unkontrollierbar war und ist. Erst in den vergangenen Monaten hat die Bundesregierung im Zusammenhang mit der Londoner Afghanistan-Konferenz quantifizierbare „Benchmarks“ entwickelt, die es erlauben, in Abstimmung mit den Nato-Partnern in den verbleibenden drei bis vier Jahren den Verlauf und die Wirksamkeit der ISAF-Mission kontinuierlich zu kontrollieren.
Nur wenn es gelingt, den Prozess der Übergabe sicherheitspolitischer Verantwortung an die afghanischen Behörden an Termine zu binden, messbar zu machen und zu konditionalisieren, wird der ISAF-Einsatz und damit auch der deutsche Afghanistan-Einsatz in der noch verbleibenden Zeit ausreichend innenpolitische Legitimität genießen.
Markus Kaim ist Leiter der Forschungsgruppe „Sicherheitspolitik“ der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

Inhalte verfügbar in :
Regionen und Themen
Verwendung
So zitieren Sie diese VeröffentlichungTeilen
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere Veröffentlichungen
Deutsch-französische Impulse für eine europäische Verteidigungspolitik – zwischen Gestaltungsanspruch und Defiziten
Mehr als 60 Jahre nach dem Élysée-Vertrag und sieben Jahre nach dem Vertrag von Aachen bleibt das deutsch-französische Tandem ein zentraler Machtfaktor innerhalb der Europäischen Union. Beide Länder bündeln einen erheblichen Teil des europäischen Bruttoinlandsprodukts, der industriellen Kapazitäten und der politischen Gestaltungsmacht. Gleichzeitig ist das Kräfteverhältnis im Jahr 2026 asymmetrischer geworden. Deutschland tritt unter Kanzler Friedrich Merz selbstbewusst als finanz- und sicherheitspolitisches Schwergewicht auf, während Frankreich politisch geschwächt ist.
Merz' Europapolitik: das Ende vom "German vote"?
Friedrich Merz’ Ziel ist es, Deutschland von der oft zögerlichen Rolle der vergangenen Jahre zu einem klar erkennbaren Gestaltungsakteur in der Europäischen Union zu machen, der seine Verantwortung für die europäische Integration offensiv wahrnimmt. Kern dieses Anspruchs ist das Versprechen, den „German vote“ zu überwinden – also jene Konstellationen, in denen Deutschland aufgrund innerstaatlicher Abstimmungsprobleme in Brüssel keine eindeutige Position bezieht und so die europäische Entscheidungsfindung blockiert.
Zwischen Vorstellung und gelebter Realität: die deutsch-französische Grenze als europäisches Zukunftslabor
In Europa ist die Frage der Grenzen alles andere als nebensächlich. Nach Angaben des Europäischen Parlaments umfassen die Grenzregionen rund 40 % des Territoriums der Europäischen Union (EU), beherbergen 30 % ihrer Bevölkerung und erwirtschaften nahezu ein Drittel ihres Bruttoinlandsprodukts.
Ein deutsch-französischer „Reset“? Die Ambitionen des deutsch-französischen Ministerrats - Herausforderungen einer gemeinsamen Führungsrolle in Europa.
Friedrich Merz ist als rheinischer Katholik ein Erbe der deutsch-französischen Politik der CDU, von Konrad Adenauer über Wolfgang Schäuble bis hin zu Helmut Kohl. Auch wenn die deutsch-französische Rhetorik und Denkweise bei ihm tief verwurzelt sind, muss man ihre Ergebnisse dennoch relativieren.






