Das schwere Erbe der SPD-Politik gegenüber Wladimir Putins Russland
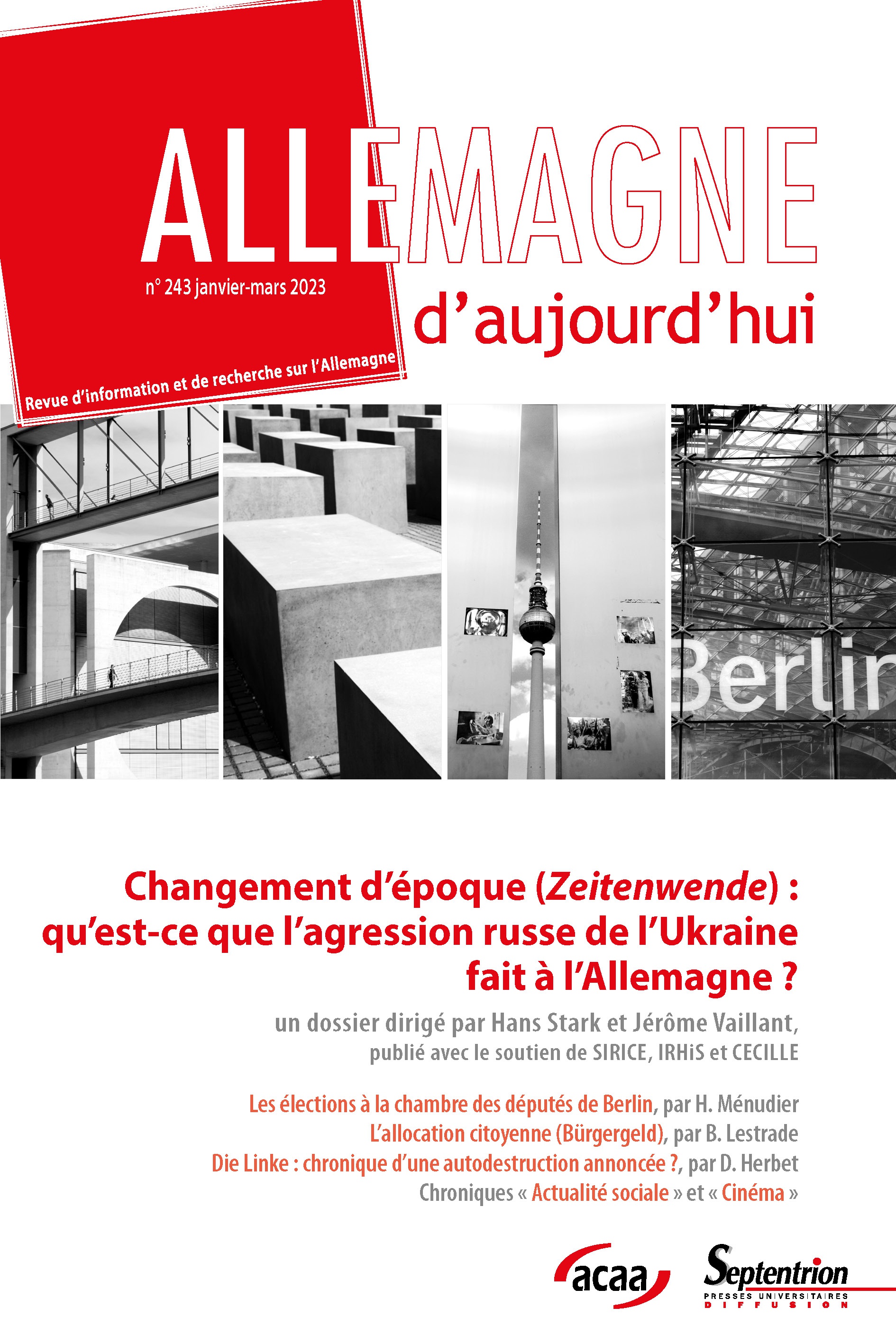
Die SPD blickt mit Stolz auf die Geschichte der Ostpolitik zurück, die aus ihrer Sicht den Weg zur deutschen Wiedervereinigung geebnet hat. Mit em festen Willen diese Ostpolitik auch nach dem Ende des Kalten Krieges weiter zu führen, haben SPD-Politiker der letzten 20 Jahre im Rahmen ihrer Regierungsverantwortung auf eine Partnerschaft mit Russland gesetzt, die zum Ziel hatte durch bilateralen Handel und gegenseitige Verflechtung Russland zu demokratisieren.
Diese Politik wurde verfolgt, obwohl sich bereits ab 2000 die Tatsache abzuzeihnen begann, dass mit Präsident Putin eine Person im Kreml herrschte, der die Grenzen Russlands mit militärischer Gewalt zu ändern versuchen würde. Und für den der Westen kein Partner, sondern ein Feindbild war. Trotz dieser Tendenzen, vor denen die ostmitteleuropäischen Partner die Deutschen und insbesondere die Akteure um Schröder, Steinmeier und Gabriel herum – allesamt aus Niedersachsen – hat sich die SPD nicht davon abhalten lassen – mit der Zustimmung der CDU von Angela Merkel – Deutschland energiepolitisch von Russland abhängig werden zu lassen und militärich die Bundeswehr nicht auf einen möglichen Konflikt mit Russland in Osteuropa vorzubereiten. Für dieses Versagen trägt die SPD eine hohe historische Schuld.
Hans Stark ist Professor für zeitgenössische deutsche Landeskunde an der Sorbonne Universität und Berater für die deutsch-französischen Beziehungen im Ifri.
Diese Publikation ist auf Französisch verfügbar: Allemagne d'aujourd'hui, n° 243, janvier-mars 2023 (S. 91-104).
Verwandte Zentren und Programme
Weitere Forschungszentren und ProgrammeMehr erfahren
Unsere VeröffentlichungenBundeswehr: Von der Zeitenwende zum Epochenbruch
Die von Olaf Scholz am 27. Februar 2022 angekündigte Zeitenwende schaltet einen Gang höher. Finanziert durch die Verfassungsreform der „Schuldenbremse” vom März 2025 und getragen von einem breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens zugunsten der Stärkung und Modernisierung der Bundeswehr, dürften die militärischen Kapazitäten Deutschlands in den nächsten Jahren rasch zunehmen. Vor dem Hintergrund sich wandelnder transatlantischer Beziehungen wird Berlin eine zentrale Rolle bei der Verteidigung des europäischen Kontinents zukommen, wodurch sich seine politisch-militärische Position auf dem Kontinent radikal verändert.

ESSI: Wie können die Divergenzen überwunden werden?
Die European Sky Shield Initiative hat zu zahlreichen Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland geführt. Fortschritte sind jetzt in Sicht.

Deutsch-französische Impulse für eine europäische Verteidigungspolitik – zwischen Gestaltungsanspruch und Defiziten
Mehr als 60 Jahre nach dem Élysée-Vertrag und sieben Jahre nach dem Vertrag von Aachen bleibt das deutsch-französische Tandem ein zentraler Machtfaktor innerhalb der Europäischen Union. Beide Länder bündeln einen erheblichen Teil des europäischen Bruttoinlandsprodukts, der industriellen Kapazitäten und der politischen Gestaltungsmacht. Gleichzeitig ist das Kräfteverhältnis im Jahr 2026 asymmetrischer geworden. Deutschland tritt unter Kanzler Friedrich Merz selbstbewusst als finanz- und sicherheitspolitisches Schwergewicht auf, während Frankreich politisch geschwächt ist.
Merz' Europapolitik: das Ende vom "German vote"?
Friedrich Merz’ Ziel ist es, Deutschland von der oft zögerlichen Rolle der vergangenen Jahre zu einem klar erkennbaren Gestaltungsakteur in der Europäischen Union zu machen, der seine Verantwortung für die europäische Integration offensiv wahrnimmt. Kern dieses Anspruchs ist das Versprechen, den „German vote“ zu überwinden – also jene Konstellationen, in denen Deutschland aufgrund innerstaatlicher Abstimmungsprobleme in Brüssel keine eindeutige Position bezieht und so die europäische Entscheidungsfindung blockiert.









